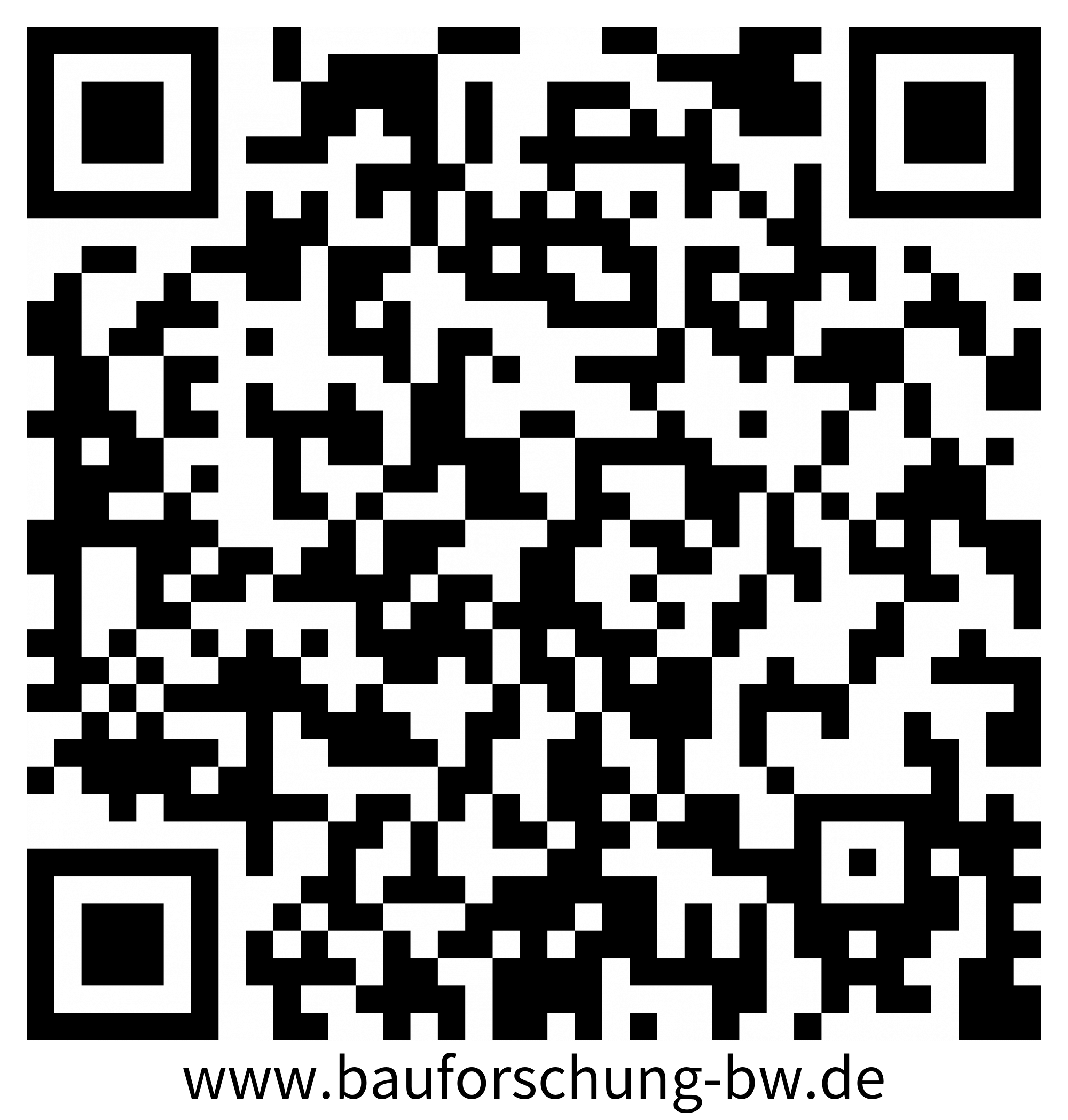Abgegangenes Wohnhaus (Rest der Stadtmauer und Gewölbekeller)
Datenbestand: Bauforschung und Restaurierung
Objektdaten
| Straße: | Schwanengasse |
| Hausnummer: | 18 |
| Postleitzahl: | 89584 |
| Stadt-Teilort: | Ehingen |
|
|
|
| Regierungsbezirk: | Tübingen |
| Kreis: | Alb-Donau-Kreis (Landkreis) |
| Wohnplatzschlüssel: | 8425033012 |
| Flurstücknummer: | keine |
| Historischer Straßenname: | keiner |
| Historische Gebäudenummer: | keine |
| Lage des Wohnplatzes: |

|
Kartenansicht (OpenStreetMaps)
Ehem. Heilig- Geist Spital, profanierte Kapelle, jetzt städt. Museum, Kasernengasse 2 (89584 Ehingen (Donau))
Rathaus (Turm), Marktplatz 1 (89584 Ehingen (Donau))
Ehem. Franziskanerkloster, Spitalstraße 30 (89584 Ehingen (Donau))
Brücke über die Schmiech, Bahnhofstraße (89584 Ehingen)
Wohnhaus, Burghof 1 (89584 Ehingen)
Abgegangenes Gebäude, Gymnasiumstraße 7 (89584 Ehingen)
Wohn- und Geschäftshaus, Hauptstraße 21 (89584 Ehingen)
Wohnhaus, Hauptstraße 71 (89584 Ehingen)
Kolleg St. Josef (Altbau), Müllerstraße 8 (89584 Ehingen)
Ehem. Oberschaffnei, Schulgasse 21 (89584 Ehingen)
Teil der Stadtmauer , Schulgasse 21 (89584 Ehingen)
Stadtmauerreste (89584 Ehingen, Schwanengasse 22, 26, 28)
Stadtmauerrest, Schwanengasse 26, Schwanengasse 26 (89584 Ehingen)
Wohnhaus, Tränkberg 4 (89584 Ehingen)
Wohnhaus, Tuchergasse 40 (89584 Ehingen)
Bauphasen
Die bauliche Entwicklung von Stadtmauer, Anschlussbebauung und Kelleranlage lässt sich nach den momentan vorliegenden Befunden folgendermaßen zusammenfassen:
- Phase l a: Kernbestand der Stadtmauer und ausdehnungsmäßig nicht genauer greifbare nordseitige Anschlussbebauung, die über die Deckenbalkenlöcher an der Nordseite der Stadtmauer nachgewiesen ist. Anhand des Baubefundes nicht genauer datierbar, möglicherweise 13., eher 14. Jahrhundert.
- Phase l b: Evtl. nachträglich Anlegung der beiden heute vermauerten Lichtschlitze und eindeutig nachträglich Aufbringung des glatten lnnenputzes, der auf eine Wohnnutzung des Anschlussgebäudes hinweist.
- Phase ll: Erdgeschossmauerwerk des östlichen Anschlussbaukörpers. Anhand des Baubefundes nicht genauer datierbar, vermutlich 14./ 15. Jahrhundert.
- Phase lll: Erdgeschossmauerwerk des westlichen Anschlussbaukörpers und zugehörig die heute nur noch in Schwellresten vorhandene spätmittelalterliche Fachwerkkonstruktion, 15. Jh. Vermutlich gleichzeitig Vermauerung der beiden Nischen in der Stadtmauer und Aufmauerung der inneren Mauerschale.
- Phase lV a: Anlegung bzw. Abtiefung der beiden Gewölberäume im südlichen Teil des westlichen Anschlussbaukörpers, beide Kellerräume mit getrennter nordseitiger Erschließung und zunächst noch freiem Zwischenraum zwischen der Nordwand des Kellers und der nördlichen Außenwand des Gebäudes. Die umfangreiche Backsteinverwendung macht eine nachmittelalterliche Entstehung wahrscheinlich, die vom 16. bis zum 18. Jahrhundert reichen kann.
- Phase IV b: Schließung der Lücken zwischen der nördlichen Kellerwand und der nördlichen Außenwand des Gebäudes.
- Phase V: Aufgabe des Außenzuganges des westlichen Kellers und Anlegung einer Türöffnung in der Trennwand zwischen den beiden Kellerräumen. Verwendung von Backstein und Bruchstein weist vermutlich noch in die erste Hälfte des 19. Jahrhunderts. lm 19. Jahrhundert auch Ausbrechen eines Teiles der inneren Mauerschale am östlichen Mauerende und Anlegung des großen Durchganges westlich daneben.
- Phase VI: Am Übergang zum 19. zum 20. Jahrhundert weiteres Ausbrechen der Mauerschale am westlichen Mauerende und Anlegung der dortigen Türöffnung.
2010 wurde das Gebäude abgetragen und durch einen Neubau ersetzt.
(1200 - 1399)
- Siedlung
- Stadt
- Befestigungs- und Verteidigungsanlagen
- Stadtmauer
(1300 - 1499)

- Erdgeschoss
(1400 - 1499)

- Erdgeschoss
(1500 - 1799)
(1800 - 1899)
(2010)
Zugeordnete Dokumentationen
- Bauhistorische Untersuchung
- Bauaufnahme der Scheuer
Beschreibung
- Siedlung
- Stadt
- Befestigungs- und Verteidigungsanlagen
- Stadtmauer
Zonierung:
Konstruktionen
- Steinbau Mauerwerk
- Bruchstein
Der Stadtmauerzug zieht sich homogen über die ganze Länge hinweg. lm Osten endet er mit einer Abbruchkante, an die das dem späten 19. oder frühen 20. Jahrhundert entstammende Ortbetonmauerwerk der benachbarten Scheune anschließt. Ursprünglich setzte sich die Mauer hier geradlinig weiter nach Osten fort. An ihrem westlichen Ende endet die Mauerscheibe ebenfalls mit einem Mauerabbruch, der aber mit kleinformatigen Kalkbruchsteinen zu einer sauberen Kante abgemauert worden ist. Hierbei dürfte es sich um eine Vormauerung des 19. Jahrhunderts handeln.