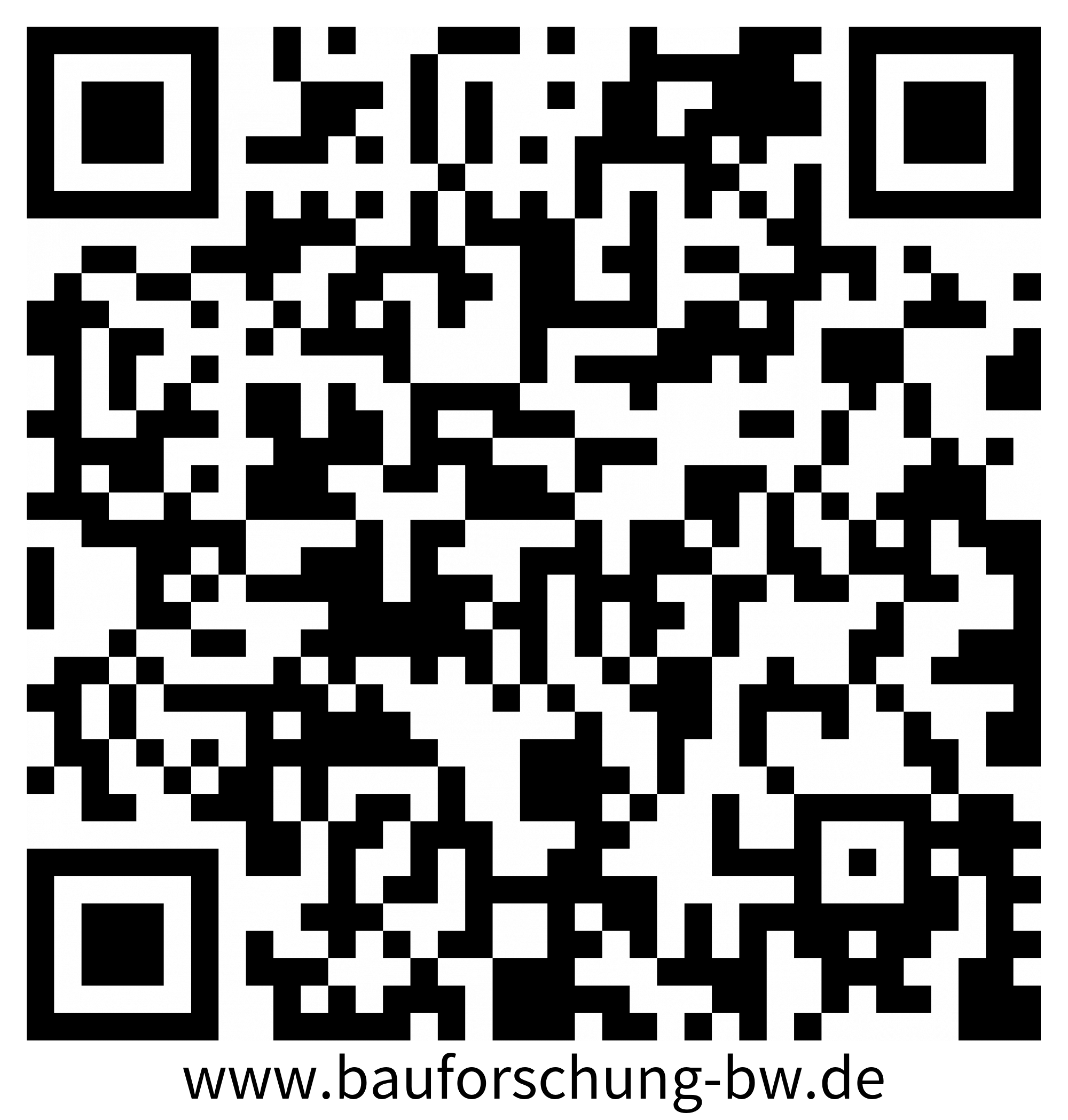Ehem. Heilig- Geist Spital, profanierte Kapelle, jetzt städt. Museum
Datenbestand: Bauforschung und Restaurierung
Objektdaten
| Straße: | Kasernengasse |
| Hausnummer: | 2 |
| Postleitzahl: | 89584 |
| Stadt-Teilort: | Ehingen (Donau) |
|
|
|
| Regierungsbezirk: | Tübingen |
| Kreis: | Alb-Donau-Kreis (Landkreis) |
| Wohnplatzschlüssel: | 8425033012 |
| Flurstücknummer: | keine |
| Historischer Straßenname: | keiner |
| Historische Gebäudenummer: | keine |
| Lage des Wohnplatzes: |

|
Kartenansicht (OpenStreetMaps)
Rathaus (Turm), Marktplatz 1 (89584 Ehingen (Donau))
Ehem. Franziskanerkloster, Spitalstraße 30 (89584 Ehingen (Donau))
Brücke über die Schmiech, Bahnhofstraße (89584 Ehingen)
Wohnhaus, Burghof 1 (89584 Ehingen)
Abgegangenes Gebäude, Gymnasiumstraße 7 (89584 Ehingen)
Wohn- und Geschäftshaus, Hauptstraße 21 (89584 Ehingen)
Wohnhaus, Hauptstraße 71 (89584 Ehingen)
Kolleg St. Josef (Altbau), Müllerstraße 8 (89584 Ehingen)
Ehem. Oberschaffnei, Schulgasse 21 (89584 Ehingen)
Teil der Stadtmauer , Schulgasse 21 (89584 Ehingen)
Abgegangenes Wohnhaus (Rest der Stadtmauer und Gewölbekeller), Schwanengasse 18 (89584 Ehingen)
Stadtmauerreste (89584 Ehingen, Schwanengasse 22, 26, 28)
Stadtmauerrest, Schwanengasse 26, Schwanengasse 26 (89584 Ehingen)
Wohnhaus, Tränkberg 4 (89584 Ehingen)
Wohnhaus, Tuchergasse 40 (89584 Ehingen)
Bauphasen
Das Heilig-Geist-Spital wurde aus Spenden Ehinger Bürger um 1340 gegründet. Im 16. Jahrhundert wurde es baulich erweitert. Es entstanden weitere, um einen Hof gruppierte Ökonomiegebäude, die heute nicht mehr bestehen. 1532 wurde das das sog. Neuhaus als Fachwerkkonstruktion errichtet. Es diente bis 1976 unterschiedlichen Nutzungen. 1977- 84 wurde es umfangreich saniert.
Die Spitalkapelle aus der Zeit um 1500 besitzt bauzeitliche als auch manieristische Gemälde aus der Zeit um 1600. 1828 erfolgte die Profanierung der Kapelle und der Umbau zum Getreidespeicher. Dabei wurden Zwischenböden eingebaut und die gesamte Innenausstattung entfernt wie auch die gotischen Fenster der neuen Nutzung angepasst. Die Gemälde wurden übertüncht. Von 2001 bis 2006 erfuhr die Kapelle eine umfangreiche Sanierung.
Kapelle und Neuhaus werden heute als städtisches Museum genutzt.
(1340)
- Siedlung
- Stadt
- Bauten für Wohlfahrt und Gesundheit
- Spital
(1500)

- Ausstattung
- Sakralbauten
- Kapelle, allgemein
- Detail (Ausstattung)
- bemerkenswerte Wand-/Deckengestaltung
(1500 - 1599)

- Anbau
- Ländl./ landwirtschaftl. Bauten/ städtische Nebengeb.
- Ökonomiegebäude
(1532)
- Holzgerüstbau
- allgemein
(1600)

- Ausstattung
- Detail (Ausstattung)
- bemerkenswerte Wand-/Deckengestaltung
(1827 - 1828)
- Ländl./ landwirtschaftl. Bauten/ städtische Nebengeb.
- Lagergebäude
(1976)
(1977 - 1984)
(2001 - 2006)
Zugeordnete Dokumentationen
- Bauhistorische Untersuchung
Beschreibung
- Siedlung
- Stadt
- Anlagen für Bildung, Kunst und Wissenschaft
- Museum/Ausstellungsgebäude
Zonierung:
Konstruktionen
- Steinbau Mauerwerk
- allgemein
- Bruchstein
- Verwendete Materialien
- Putz
- Dachform
- Satteldach mit einseitigem Vollwalm
Von der ursprünglichen Einwölbung der Kapelle haben sich nur noch geringe Reste erhalten. Gut erkennbar sind im Erdgeschoss in den Ecken und an den Wänden stehende runde Dienste, die auf der Höhe der Erdgeschossdecke gekappt worden sind. Sie besitzen runde Sockel mit einer spiraligen Kannelur. Die Anordnung der Dienste belegt, dass der westliche Bereich des Kapellenraumes als Schiff in drei schmale Zonen geteilt war. Durch einen Chorbogen, der über im Erdgeschoss noch vorhandene Mauerwangen ablesbar ist, war davon ein Chorraum abgeteilt, der in eine Querzone und einen ostseitigen 3/8-Schluss gegliedert war. Während die Dienste ansonsten direkt am Boden enden, setzen sie in den schiffseitigen Ecken der Mauerzungen des Chorbogens erst in Brusthöhe an. Wahrscheinlich nehmen sie dabei Bezug auf hier schon ursprünglich vorhandene Seitenaltäre. Die Ansätze der einstigen Einwölbung an den Außenwänden lassen sich im Bereich des zweiten und dritten Obergeschosses noch anhand von Putzabdrücken verfolgen. Der Gewölbeverlauf ist dabei an den Längswänden, im Chorbereich und an den Enden der Westwand noch über weite Strecken gut abzulesen. Geht man von einer einschiffigen Einwölbung aus, so muss die Gewölbeschale über die Traufhöhe hinaus ursprünglich in den Dachraum hineingereicht haben.
Dem entspricht auch die Ausbildung des ursprünglichen Dachwerkes, das eine um etwa 1,5 m gegenüber der Traufhöhe angehobene Dachbalkenlage zeigt. Auch wenn sich an der westlichen Stirnseite oberhalb des heutigen Dachgebälkes kein Abdruck der einstigen Einwölbung zeigt, so wird man diesen Befunden zufolge doch von einer einschiffigen Einwölbung ausgehen dürfen.
Die Einwölbung des Kellergeschosses mit den kräftigen Mittelpfeilern könnte den Verdacht auf eine zweischiffige Einwölbung des Kapellenraumes aufkommen lassen. Doch sind die Mittelpfeiler des Kellergewölbes in ihrer Lage, außer in der westlichsten Querachse, nicht auf die durch die Dienste vorgegebenen Gewölbequerachsen bezogen und können so auch nicht als Unterbau für eventuelle Mittelpfeiler des Kapellenraumes gedient haben.
Beim Umbau der Kapelle nach 1827 wurden den archivalischen Unterlagen zufolge der Chorbogen und die Einwölbung des Chores abgetragen. Beides muss demnach bis zu diesem Zeitpunkt erhalten geblieben sein.
Nicht erwähnt wird hingegen der Abbruch eines Gewölbes über dem Kapellenschiff. Wie die restauratorische Untersuchung ergeben hat, waren im Bereich des Schiffes die Gewölbedienste wohl noch bis um 1827 erhalten, während das Gewölbe schon zu einem früheren, aber nicht genauer festlegbaren Zeitpunkt entfernt worden war.
Ursprüngliches Dachwerk
Vom ursprünglichen Dachwerk hat sich heute nur noch ein Teil der westlichen Giebelscheibe erhalten. Alle weiteren Teile wurden bei der Instandsetzung von 1976 vollständig entfernt und durch die heutige, moderne Dachkonstruktion ersetzt.
In der westlichen Giebelscheibe haben sich umfangreiche Reste eines mittelalterlichen Dachquerschnittes erhalten. Etwa 1,4 m oberhalb der heutigen Dachbalkenlage befindet sich ein durchgängiger, sehr kräftiger Dachbalken aus Nadelholz. An seinen Enden weist er unterseitig jeweils eine Verkämmung für einen einstigen Längsunterzug auf. Diese Längsunterzüge waren in der Giebelachse durch kurze, aber kräftige Ständer getragen, die heute noch über Negativformen im Mauerwerk der westlichen Giebelscheibe ablesbar sind. Die Aussteifung dieser Ständer erfolgte durch eichene Bänder, die von außen her aufsteigend den Ständer überblatteten und zumindest bis zum hochliegenden Dachbalken durchlaufen. Reste dieser Bänder, die nur eine geringe Stärke von 5-6 cm und eine Breite um 13-14 cm aufweisen, haben sich heute noch im Mauerwerk der Giebelscheibe erhalten. Sie weisen darauf hin, dass sich in der westlichen Giebelscheibe zumindest an den Wandenden einst eine Schwelle befunden hat, die heute aber nicht mehr erkennbar ist.
Auf dem hochliegenden Dachbalken stehen innerhalb der Giebelwand drei eichene Bundständer. Auf allen drei Ständern haben sich noch die gekappten Enden einstiger Längspfetten bzw. -unterzüge erhalten, auf denen ein Kehlbalken aufliegt. Blattsassen an allen drei Ständern weisen zudem auf eine einstige kopfzonige Aussteifung zwischen Ständern und Unterzügen bzw. Pfetten hin. Das einstige Gespärre lässt sich im unteren Wandbereich nur noch vereinzelt über Abdrücke im Giebelmauerwerk ablesen. Der Wandbereich oberhalb des Kehlbalkens war einer eingehenden Untersuchung nicht zugänglich. Die vorhandenen Befunde lassen erkennen, dass die Dachkonstruktion mit dem hochliegenden Dachbalken so angelegt war, dass die einstige Einwölbung des Kapellenraumes über die Traufhöhe hinaus in den Dachraum hineinreichen konnte. Derartige Verhältnisse sind aus den Bestandsplänen des letzten Umbaus auch im Längsschnitt durch das Dachwerk noch ablesbar (nicht eindeutig im Querschnitt). Dies bedeutet, dass vor dem letzten Umbau über dem Kapellenschiff und wohl auch im Chorbereich noch das mittelalterliche Dachwerk erhalten gewesen sein dürfte.
Deutlich zu erkennen ist, dass die Holzkonstruktion der westlichen Giebelscheibe erst nachträglich von Mauerwerk umschlossen wurde. Unterhalb des hochliegenden Dachbalkens befindet sich ein hoher Mauerstreifen aus Bruchsteinmauerwerk, der raumseitig die Abdrücke einer Verbretterung zeigt. Hier wurde also von außen gegen eine vorhandene Verbretterung (oder entsprechende Holzkonstruktion) gegengemauert. Zwischen dieser Bruchsteinmauerwerksscheibe und dem hochliegenden Dachbalken befindet sich ein schmaler Streifen mit Backsteinmauerwerk, auf dem der hochliegende Dachbalken sauber aufliegt. Die höhergehenden Wandbereiche sind mit Bruchsteinmauerwerk geschlossen, das die vorhandene Holzkonstruktion dreiseitig umschließt.
Keller
Der Kapellenraum ist zur Gänze unterkellert. Entlang der Westseite befindet sich eine schmale Quertonne, während sich unter dem größeren Restbereich zwei parallele Längstonnen befinden. Sie ruhen jeweils in der Mittelachse auf kräftigen, in Tuffstein gemauerten Pfeilern, während die Gewölbeschale selber in Backstein gemauert ist. Bis auf die westlichste innere Querachse liegen die Achsen der Gewölbepfeiler nicht in den Achsen der Einwölbung des Kapellenraumes.
ln der westlichsten Querachse ist der dortige Mittelpfeiler nach Norden und Süden mit zwei Mauerzungen aufgeweitet. An ihnen setzen nach Norden und Süden hin in Backstein gemauerten Gurtbögen an (der nördliche heute nur noch fragmentarisch erhalten), die wie die Mauerzungen im Kern zum bauzeitlichen Bestand gehören. Die Einwölbung der Kellerfenster an Nord- und Südseite nimmt mit einem deutlichen Verzug auf diese Bogenachse Rücksicht.
Der ursprüngliche Kellerzugang ist im nördlichen Abschnitt der Westwand zu suchen, wo in einer breiten Nische eine gewölbte Stichkappe schräg nach außen führt. Diese Öffnung ist im Erdgeschoss nochmals durch einen Entlastungsbogen abgefangen. Der heutige Eingang an der Nordseite scheint hingegen erst nachträglich (im 19. Jh.?) durch die Erweiterung eines einstigen Fensters entstanden zu sein.